Interview mit John le Carré Frage: In welcher Beziehung steht Ihr neues Buch zu den bisherigen? Stellt es eine Rückkehr zu Ihrem alten Stil dar, oder sehen Sie darin eine neue Richtung? Antwort: Darüber muß die Kritik befinden. Und mit dem kritischen Prozeß habe ich ja nichts zu tun. Ich mag dieses Buch jedenfalls sehr. Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. Ich mußte meine Figuren nur anstupsen, schon lief alles so, wie ich wollte. Ich bin die Geschichte mit ziemlich viel Wut angegangen, und meine Figuren haben diese Wut für mich zum Ausdruck gebracht. Ich wollte einen Thriller schreiben, und beim Schreiben hat mich genau die gleiche Angst gepackt, wie sie hoffentlich auch meine Leser packt. Was mich verblüfft hat, war die Ökonomie des Ganzen. Normalerweise arbeite ich nicht so sauber. Aber diesmal gab es keine falschen Spuren, keine Sackgassen, keine riesigen Mengen von Ausschuß wie sonst so oft. Ich hatte in meine Vergangenheit gegriffen, und der Instinkt oder ein glücklicher Zufall hatten mich genau die Figuren und Hintergründe herausziehen lassen, die ich brauchte. Frage: Heißt das, Sie hatten die Figuren bereits fertig im Kopf, bevor Sie überhaupt mit dem Schreiben begonnen haben? Antwort: Es gibt zwei Figuren in diesem Buch, die sich schon lange vorher in meinem Schriftstellergedächtnis eingenistet hatten und auf ihren Auftritt warteten. Manche Figuren sind so. Sie reifen in der Flasche, zum Teil über Jahrzehnte. Dieser alte Mann zum Beispiel, den ich einmal in St. John's Wood getroffen habe. Er saß auf einer Bank, die Einkäufe einer ganzen Woche zu seinen Füßen, und weinte. Als ich ihn fragte, warum, sagte er mir, das Geschimpfe seiner Frau sei ihm so unerträglich geworden, daß er einfach nicht den Mut zum Heimgehen aufbringe. Oder der zwölfjährige Junge in dem Krankenhaus in Palästina, dem eine Streubombe beide Beine weggerissen hatte und der alle, die an seinem Bett vorübergingen, mit hochgerecktem Daumen begrüßte. Diese beiden habe ich bisher noch nirgends untergebracht. Bei dem alten Mann habe ich es in Geheime Melodie versucht, aber irgendwie wollte er sich nicht einbauen lassen. Und über den palästinensischen Jungen werde ich wahrscheinlich niemals schreiben können. Er ist für mich nicht einfach eine Romanfigur, er ist ein Symbol nicht zu unterdrückender Tapferkeit. Dafür konnte ich über einen anderen Jungen schreiben, einen einundzwanzigjährigen Tschetschenen namens Issa, den ich 1992 bei meinen Recherchen zu Unser Spiel in Moskau kennengelernt hatte. Er war ein Aussteiger, halb Tschetschene, halb Russe, und wohnte in einem muslimischen Getto in den Moskauer Außenbezirken. Im Haus trug er immer eine Pistole im Gürtel. In Moskau mußte man damals (wie heute übrigens auch noch) nur asiatisch aussehen, um verhaftet zu werden - und Issa sah asiatisch aus. Ich war mit ihm nie auf der Straße unterwegs, deshalb weiß ich nicht, ob die Pistole ihn außer Haus begleitete. Er war groß und ausgemergelt und gab sich fast aufreizend würdevoll, trotz oder gerade wegen der Tatsache, daß seine halbrussische Abstammung ihn zum Gespött der echten Tschetschenen machte. Für die tschetschenische Sache kämpfte er aus Opposition gegen seinen Vater, einen ehemaligen Oberst der russischen Besatzungsarmee. Seine Mutter war ein Mädchen aus den tschetschenischen Bergen gewesen, und ihre eigenen Leute hatten sie dafür bestraft, daß sie vergewaltigt worden war: die Dorfältesten sahen es - wodurch auch immer - als erwiesen an, daß sie willfährig gewesen war und kommandierten zur Wiederherstellung der Familienehre ihre männlichen Angehörigen dazu ab, sie zu töten, sobald sie ihr Kind zur Welt gebracht hatte. Als der Vater nach Moskau zurückbeordert wurde, nahm er Issa mit und gab sich alle Mühe, aus ihm einen ordentlichen Russenjungen zu machen. Die besten Schulen, alles das. Mit dem Erfolg, daß sich Issa, sobald er dazu in der Lage war, den tschetschenischen Separatisten anschloß. Und daß er zum Islam konvertierte - aus Liebe zu einer Mutter, die er nie gekannt hatte. In dem Buch, das ich jetzt plante, hatte ich endlich die ideale Rolle für Issa; ich behielt sogar seinen Vornamen bei – das tschetschenische Wort für Jesus. Wobei mein Issa im Roman natürlich nicht mehr der Issa ist, den ich damals in Moskau kannte. Um echte Menschen in Romanfiguren zu verwandeln, müssen wir unserem begrenzten Einblick in ihr Inneres nachhelfen, indem wir ihnen ein paar Züge von uns selbst verleihen. Frage: Und die zweite Figur, die schon auf ihren Einsatz gewartet hat, war Ihr quertreiberischer deutscher Agentenführer, hab ich recht? Herr Bachmann? Antwort: Nein. Der hat sich auf eigene Faust Zutritt verschafft. Ich kannte eine ganze Reihe von Bachmanns zu meiner Zeit, abgehalfterte, ausgebrannte Geheimdienstleute wie Alec Leamas in Der Spion, der aus der Kälte kam. Bachmann war aus demselben Stall. Nein, die andere Figur, die schon in meinem imaginären Wartesaal saß, war Tommy Brue, der sechzigjährige Schotte und Erbe einer angeschlagenen Privatbank, der unversehens in Issas Leben hineingezogen wird. Wie Issa hatte auch Brue einen höchst problematischen Vater. Der von Brue hat vor ihm die Bank geleitet, in Wien. Alle haben Väter in diesem Buch. Alle tragen die ganz persönlichen Kämpfe aus, die ihre Geburt und ihre Lebensumstände ihnen mit auf den Weg geben. Das ist wahrscheinlich meine Art, meine eigene schwierige Vaterbeziehung aufzuarbeiten, über die ich in Ein blendender Spion geschrieben habe. Ich habe selber eine Zeitlang in Wien gelebt. Und es ist zwar schon vierzig Jahre her, aber mir ist lebhaft der trinkfreudige schottische Bankier im Gedächtnis, der mich damals immer wieder bestürmt hat, doch ein Nummernkonto bei ihm zu eröffnen - keine Namen, keine Formalitäten. Es war nicht mein Geld, hinter dem er her war. Es ging ihm um die Kameradschaft. Er war ein einsamer Exilengländer mit einer zerbröckelnden Ehe, und Geld war nur ein Vorwand für ihn, sich an Leute anzunähern, die er mochte. Ich hatte allen Ernstes ein schlechtes Gewissen, daß ich kein Nummernkonto bei ihm aufmachte, aber dieses eine Mal siegte die Vernunft, und als ich aus Wien wegging, war er denn auch in einen unschönen Skandal verwickelt. Einen Skandal übrigens, an dem sein Vater die Schuld trug! Frage: Das waren also die beiden Figuren, die es schon gab, als Sie mit der Geschichte begonnen haben? Antwort: Es gab auch noch eine dritte Figur. Eine extrem wichtige sogar: die Stadt Hamburg. Es hat mich beim Schreiben ja immer wieder nach Deutschland zurückgezogen, so wie es auch George Smiley immer wieder zurückgezogen hat: nach Deutschland, dem Motor Europas, Deutschland mit seinem aggressiven Alleingang im zwanzigsten Jahrhundert, Deutschland, der Wiege eines so großen Teils unserer europäischen Kultur. Aber diesmal mußte es Hamburg sein, Hamburg oder gar nichts. Und in vieler Hinsicht stellt es die exotischste Figur im ganzen Buch dar. Das heutige Hamburg ist eine vitale, quirlige, schöne, selbstbewußte Stadt: kein kulturelles Juwel, aber dafür die reichste Stadt in Europa. Aber Hamburg blickt auf eine turbulente Geschichte zurück: erst Besetzung durch Napoleon, 1918 dann Machtübernahme durch die Kommunisten und 1933 durch die Nazis. 1933 lebten zwanzigtausend Juden in Hamburg, 1945 waren es keine tausend mehr. Die Bombardierung Hamburgs durch die Alliierten 1943 kostete in einer einzigen Woche mehr Menschen das Leben als der ganze Blitzkrieg gegen England oder die Atombombe auf Nagasaki: fünfundvierzigtausend. Um so mehr grenzt der Wiederaufbau Hamburgs nach dem Krieg an ein Wunder. Toleranz und Liberalismus, so lautete Hamburgs neue Parole. Was einer der Gründe sein mag, warum die Stadt unwissentlich den Nährboden für Ulrike Meinhoff und die Baader-Meinhoff-Bande abgab – und Jahre später für Mohammed Atta und ein halbes Dutzend der Flugzeugentführer vom 11. September und ihrer Mitverschwörer. Ich hatte noch ein anderes Motiv für meine Wahl, ein ganz persönliches. Ich war ein heimkehrender Sohn. Anfang der sechziger Jahre war ich britischer Konsul in dem mittlerweile geschlossenen Hamburger Generalkonsulat gewesen. Die Britische Botschaft in Bonn hatte mich in einer Eilaktion dort hinverfrachtet, nachdem ich als der Autor von Der Spion, der aus der Kälte kam enttarnt worden war. Meine Arbeitgeber hatten nichts gegen das Buch an sich, aber sie hatten nicht mit dem Aufsehen gerechnet, das meine Autorschaft erregte. Hamburg schien ihnen da angenehm weit ab vom Schuß. Da saß ich also, unschlüssig, ob ich meine Geheimdienstkarriere weiterverfolgen oder mich ganz aufs Schreiben verlegen sollte. Als ich mich dann für die Schriftstellerei entschied, verließ ich Hamburg fast heimlich. Ich erinnere mich an keinerlei Abschiede. Es war ein bißchen, als hätte ich eine Liebesaffäre mit der Stadt begonnen und wäre dann über Nacht abgereist, ohne meine Telefonnummer zu hinterlassen. Was wiederum ein starkes Bedürfnis in mir auslöste, die Beziehung da wiederaufzunehmen, wo ich sie so rüde abgebrochen hatte. Frage: Nach vierzig Jahren? Antwort: Ein paarmal war ich auch zwischendurch dort gewesen, aber nie lange genug. Es ist sicher Zufall, daß ich den 11. September 2001 in Hamburg erlebte, aber rückblickend fühlt es sich nicht so an. Ich recherchierte damals für ein ganz anderes Buch - Absolute Freunde, auch ein Roman über Deutschland -, und ich hatte mir den Vormittag über in einem Fernseharchiv Filmaufzeichnungen aus den sechziger und siebziger Jahren angesehen, in denen [[der anarchistische Studentenführer]] Rudi Dutschke seine Anhänger gegen Amerika aufpeitschte. Als ich danach ins Hotel zurückkam, erwartete mich eine Nachricht meiner Sekretärin in Cornwall: "Gehen Sie sofort zum nächsten Fernseher." Ich gehorchte und kam gerade rechtzeitig, um das zweite Flugzeug in die Zwillingstürme krachen zu sehen. Den Morgen hatte ich mit Rudi Dutschke verbracht, den Nachmittag verbrachte ich nun mit Osama bin Laden, beides erklärte Feinde des amerikanischen Kolonialismus, der Globalisierung und all dessen, was wir Fortschritt nennen. Ich blieb noch etwa eine Woche in Deutschland und hörte mir die Reaktionen von Freunden an. Nach außen hin hätte das Mitgefühl für die Vereinigten Staaten kaum größer sein können: Kerzen auf amerikanischen Türschwellen, eine herzergreifende Beileidsbekundung auf einem Transparent am Brandenburger Tor, und und und. Inoffiziell fielen die Kommentare oft harscher aus. Ein sechzigjähriger evangelischer Pfarrer meinte zu mir, es geschehe den Amerikanern ganz recht. Für seine Generation zumindest war Rudi Dutschkes Botschaft noch nicht gänzlich verhallt. Frage: Und Annabel, Ihre deutsche Bürgerrechtsanwältin, die Issa vertritt - wo kam die her? Antwort: Eigentlich hätte ich die Rolle ja gern mit einer Frau aus der ehemaligen DDR besetzt, als eine Art Gegengewicht zu Hamburgs überbordendem Materialismus, aber das traute ich mir denn doch nicht zu. Also habe ich mich statt dessen für eine Idealistin aus einer wohlhabenden Akademikerfamilie entschieden, eine Menschenrechtsanwältin, und zwar eine mit einem gehörigen Funken Rebellentum. Puritanisch, aber freidenkerisch, gegen das Establishment, aber dennoch Teil davon, und fast schon übertrieben korrekt, besonders im Umgang mit Issa. Und attraktiv. Schließlich gehört ja auch eine Portion sexueller Spannung zu einer Beziehung zwischen einem Muslim von Anfang zwanzig, der jahrelang ohne weibliche Gesellschaft auskommen mußte, und einer engagierten jungen Frau, die sich von seiner Not anrühren läßt. Der Issa, den Annabel kennenlernt, war im Gefängnis und ist gefoltert worden. Die Folter ist eine entsetzliche Art von Ritterschlag. Wir nicht Gefolterten können mit den Gefolterten niemals gleichziehen, gottlob. Wir haben ein schlechtes Gewissen ihnen gegenüber, wir wollen sie beschützen, wir glauben, ihnen alles schuldig zu sein. Daraus speisen sich Annabels Gefühle. Fügen Sie der Mischung noch meinen Bankier Brue hinzu, und der Reigen enttäuschter Liebe ist komplett. Ich fand, die Chemie stimmt. Wie ich Ihnen schon zu Anfang gesagt habe, ich mag dieses Buch. Frage: Wie wird es von den Kritikern aufgenommen werden, meinen Sie? Antwort: So wie meine Bücher immer aufgenommen werden. In meinem Alter hat man seine Fans und seine Feinde, und sie ändern sich nicht groß. Diejenigen, die mich für überschätzt halten, werden das kundtun. Diejenigen, die mich für unterschätzt halten, werden es ebenfalls kundtun. Und in ein paar Jahren wird sich sowieso keiner mehr erinnern, wie das Buch aufgenommen worden ist. Jeder halbwegs seriöse Schriftsteller hat es im Gefühl, wann er sein bestes gegeben hat und wann er hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Eine breite Leserschaft zu haben ist ein Privileg, und ich habe in dieser Hinsicht sehr viel Glück gehabt. Ich halte dieses Buch für eins meiner besten, und das macht mich sehr froh. Noch froher würde es mich natürlich machen, wenn meine Leser derselben Meinung wären. Frage: Sie sagten, Sie wären die Geschichte mit ziemlich viel Wut angegangen. Wut worüber? Antwort: Aber das ist alles heiße Luft, wenn nicht die Geschichte und die Figuren den Ball nehmen und damit loslaufen - und das machen sie in diesem Buch. Und deswegen mag ich es so.
GPSR Information
| GPSR Field |
Value |
| gpsr_manufacturer_name | zsr Verlag oHG |
| gpsr_manufacturer_street | Friedrichstr. |
| gpsr_manufacturer_housenumber | 126 |
| gpsr_manufacturer_postalcode | 10117 |
| gpsr_manufacturer_city | Berlin |
| gpsr_manufacturer_country | Deutschland |
| gpsr_manufacturer_homepage | www.ullstein-buchverlage.de |
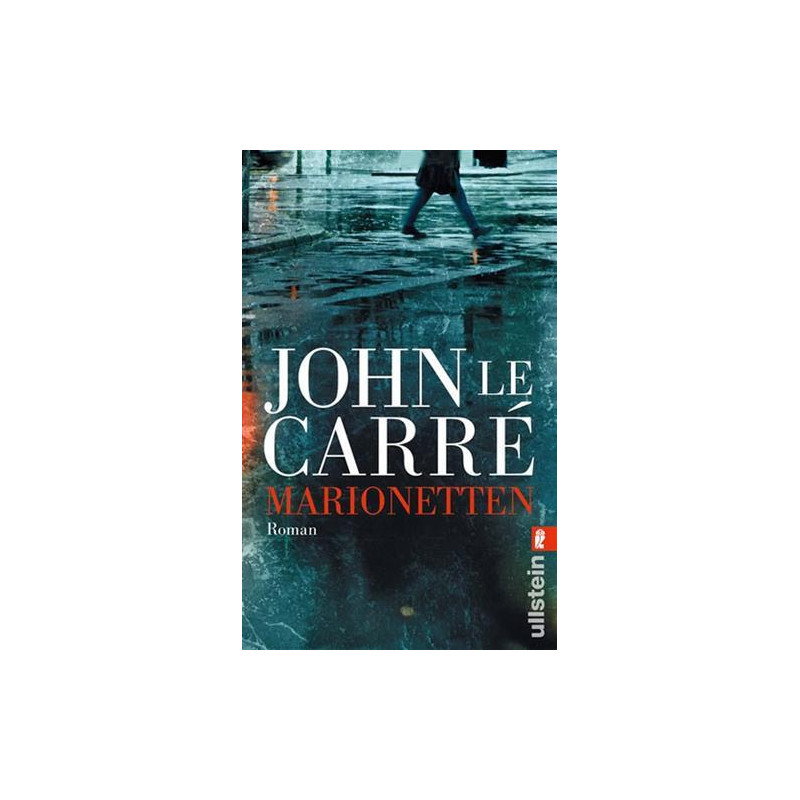
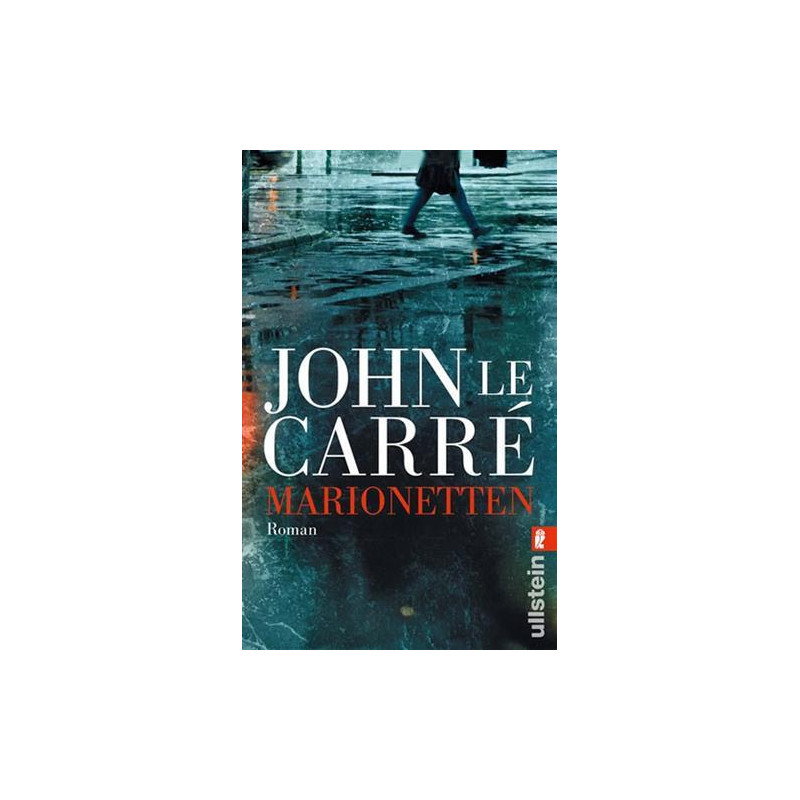

 Sicherheitsrichtlinien
Sicherheitsrichtlinien
 Lieferbedingungen
Lieferbedingungen
 Rückgabebedingungen
Rückgabebedingungen